Homosexualität – (k)ein Schicksal
Ich bin in einer adventistischen Familie aufgewachsen. Als ich vier Jahre alt war, lebten wir auf einer Farm im Süden. Meine Eltern wollten ihre Kinder vor dem schlechten Einfluss der Welt schützen. Das ländliche Leben auf der Farm schien ihnen dafür der beste Weg zu sein. Doch auch in dieser Umgebung lauerten Gefahren. Manchmal begleiteten wir Buben Papa aufs Feld. Das machte uns wirklich Spaß. Wir konnten zusehen, wie er mit den großen landwirtschaftlichen Geräten pflügte, das Land bestellte, erntete, Heuballen presste und so weiter – für Vier- und Fünfjährige ein richtiges Abenteuer.
Die Unschuld verloren

Eines Tages arbeitete Papa gerade mit dem Mähdrescher. Wir hatten ihn wieder aufs Feld hinaus begleitet. Wenn der Getreidetank im Mähdrescher voll war, wurde das Korn in einen Transporter geleert, den einer der jungen Hilfsarbeiter fuhr. Mein Bruder fuhr bei Papa auf dem Mähdrescher mit, ich bei diesem Teenager im Transporter. Wenn wir vom Abladen zurückkamen, parkten wir im Schatten eines Baumes, bis Papa signalisierte, dass der Getreidetank wieder voll war.
Man sagt ja: „Müßiggang ist aller Laster Anfang.“ Während einer der langen Wartezeiten beschloss dieser Teenager, meine Unschuld und Naivität auszunutzen. So wurde ich im zarten Alter von vier Jahren an pervertiertes Sexualverhalten herangeführt. Beschämt, traumatisiert und zutiefst schockiert versuchte ich, so zu tun, als sei nichts vorgefallen. Man könnte meinen, dass jeder „normale“ Vierjährige sofort zu Mama und Papa gerannt wäre, um sich das Geschehene von der Seele zu reden. Nicht dieses Kind! Ich fühlte mich schmutzig und schuldig, verdrängte den Vorfall und war entschlossen, niemandem davon zu erzählen. Obwohl ich das Opfer dieses pervertierten Sexualverhaltens war, glaubte ich damals mit meinen vier Jahren, ich sei irgendwie selbst daran schuld. Ich wollte, dass Mama und Papa nie erfahren würden, „was ich getan hatte“.
Eine fast normale Kindheit
In den folgenden Jahren verlief meine Kindheit oberflächlich gesehen ganz normal. Doch meine Gefühlswelt war nicht ungetrübt. Ich war fast fünf Jahre alt und hatte ein Problem mit dem Bettnässen. Meine Mutter wollte mich damit trösten, dass sie mir sagte: „Wenn du fünf bist, hast du das alles hinter dir.“ Doch am Morgen meines fünften Geburtstags wachte ich in einem nassen Bett und mit einem nassen Schlafanzug auf. Man kann sich mein Entsetzen unschwer vorstellen! Jetzt war ich fünf Jahre alt und hatte AN MEINEM GEBURTSTAG ins Bett gemacht! Ich war tief enttäuscht und schämte mich schrecklich.
An meinem sechsten Geburtstag hatte ich das Problem noch immer nicht überwunden, auch nicht an meinem siebten, achten oder neunten. Niemand konnte das verstehen, vor allem ich selbst nicht. Als ich neun Jahre alt war, ließen meine Eltern meine Nieren untersuchen. Ergebnis: Organisch war alles in Ordnung. Also wurde ich ohne Lösung oder Diagnose wieder nach Hause geschickt.
Meine Geschwister machten sich inzwischen über nichts lustiger als über mich, und auch in der Schule hatten die Kinder bald mitbekommen, dass ich ein Problem hatte. Je verzweifelter ich wurde, desto weniger Kontrolle hatte ich scheinbar darüber, bis ich manchmal sogar in der Schule einen „Unfall“ hatte.
Papa verstand es auch nicht. Seine Methode, mit der Situation umzugehen, bestand darin, mich so zu beschämen, dass ich mich zusammenreißen würde. Anscheinend dachte er, ich sei zu faul, auf die Toilette zu gehen, als stünde es in meiner Macht, mich für oder gegen das Bettnässen zu entscheiden. Es kam ihm nie in den Sinn – mir und anderen auch nicht –, dass es eine andere Ursache für mein Problem geben könnte.
Fantasien und Schuldgefühle
Ich hielt mich für unnormal, und dies wurde noch dadurch verschlimmert, dass ich schon sehr früh romantische, ja sexuelle Fantasien hegte, die auch nicht normal waren, sondern sich auf Männer richteten. Es war eben ein junger Mann gewesen, der mich an Sexualverhalten herangeführt hatte, und zwar an pervertiertes Sexualverhalten. Und da ich keine andere Form von Sexualität kannte, geschah es oft, dass ich den Vorfall in diesem großen Transporter unter dem Baum im Geiste noch einmal erlebte. Pervertierte sexuelle Fantasien spielten in meinem Denken, seit ich vier war, eine zunehmend größere Rolle. Ich hatte deshalb große Schuldgefühle, schien aber meine Gedanken nicht kontrollieren zu können. Bis zu einem gewissen Grad hatte ich Angst vor Männern, doch gleichzeitig fühlte ich mich eigenartig zu ihnen hingezogen. Es war eine Faszination, die mir irgendwie unnormal vorkam. Ich sehnte mich nach ihrer Anerkennung und körperlichen Zuneigung. Doch gleichzeitig fühlte ich mich schuldig wegen dieser Sehnsucht. Meine Gefühle waren ein reines Chaos.
Das Bettnässen und meine perverse Fantasie ließen mich glauben, dass ich anders war, unnormal. So wuchs ich mit sehr wenig Selbstbewusstsein auf, auch wenn die meisten Leute davon nichts merkten, weil ich in der Schule überragende Leistungen brachte und auch sehr musikalisch war.
Trotz allem empfand ich unsere Kindheit als völlig normal, wenigstens für unsere Begriffe, und in vieler Hinsicht war es auch so. Im Großen und Ganzen waren wir Kinder recht zufrieden. Das Landleben machte so viel mehr Spaß als das Leben in der Stadt.
Ich erzähle meine Geschichte aber aus einem anderen Blickwinkel. Es geht mir darum zu untersuchen, was zweifellos dazu beigetragen hat, dass ich homosexuell wurde, als ich zum Mann heranreifte. Daher die Aufzählung von Erlebnissen, an die ich mich eher ungern erinnere.
Die Sache mit Danny
Im Alter von dreizehn Jahren war ich in der achten Klasse und gehörte zu den Jungen, die etwas später in die Pubertät kamen als andere. Das hatte in mancher Hinsicht Vorteile. Im Schulchor sang ich noch mit den Mädchen im Alt. Da ich die zweite Stimme so gut singen konnte, wurde ich mit drei anderen Jungen für ein Gospelquartett ausgewählt. Dort sang ich den ersten Tenor, da ich noch nicht im Stimmbruch war. Die anderen drei waren schon fünfzehn, gingen in die neunte Klasse und besetzten die anderen drei Stimmen.
Wir wurden schnell ziemlich gut und sangen schon bald in Kirchen, in Erweckungsversammlungen und auf anderen besonderen Veranstaltungen am Wochenende. Da ich außerhalb auf dem Land wohnte, war es für meine Eltern schwierig, mich dorthin zu bringen. So lud mich einer der Jungen ein, diese Wochenenden bei ihm daheim zu verbringen. Das schien die ideale Lösung zu sein. Schließlich waren wir nicht nur beide im Quartett, sondern wurden auch immer dickere Freunde.
Freitags nach der Schule waren Danny und ich mehrere Stunden allein bei ihm zu Hause, bevor seine Eltern von der Arbeit zurückkamen. Bei einer dieser Gelegenheiten nahm Danny mich ins Schlafzimmer seiner Eltern mit, griff in eine Kommodenschublade und zog ein Buch über die Fortpflanzung und den Geschlechtsverkehr heraus (sicherlich völlig harmlos für Erwachsene). Es war voller Abbildungen, die meine jungfräulichen Augen noch nie gesehen hatten. Ich hatte zwar schon sexuell erregende Fotografien und Kunstwerke gesehen, aber noch nichts derart Eindeutiges!
Als Danny und ich dieses Buch anschauten, wurde er so erregt von den Bildern, dass er mir eröffnete, wie sehr er sich danach sehnte, die Mädchen aus der Schule zu berühren und zu spüren. Eines Tages erregte ihn das so, dass er zu meiner Überraschung anfing, an mir seine Gefühlsfantasien umzusetzen. Ich wusste nicht so recht, was ich tun sollte. Er war sehr aufdringlich, war älter als ich und mein Freund. Er sagte mir, ich solle mir keine Sorgen machen, er hätte dasselbe mit einem anderen Jungen in der Klasse auch schon getan. Er wollte wohl damit sagen, das wäre normales, annehmbares Verhalten.
Irgendwie war ich so verwundbar und so leicht einzuschüchtern, dass ich nicht wusste, wie ich mich wehren sollte, obwohl ich mich dabei unbehaglich und unwohl fühlte. Für mich war das sündig, aber ich schien mich vor dieser unangenehmen Situation nicht schützen zu können. Ich ermutigte ihn zwar nicht, aber ich ließ sein Spiel unbeweglich und passiv über mich ergehen. Diese Duldung ermunterte ihn nur noch mehr.
Diese wiederholten Zeiten ungebetener Annäherungen, Experimente und Erkundungen auf dem Gebiet der Sexualität gerieten schließlich völlig außer Kontrolle. Als ich erst einmal eingewiesen war, verfiel ich der beschämenden Gewohnheit, mich gelegentlich selbst zu befriedigen, wenn ich allein zu Hause war. Die Schuldgefühle, die mich dann überkamen, waren fast überwältigend. Ich versprach Gott, es nie, nie mehr zu tun. Mein „Bund“ mit dem Herrn taugte aber nicht viel mehr als der „alte Bund“ des alten Israel. Ich hielt eine Zeit lang durch, erlebte aber schließlich doch immer wieder einen moralischen Sündenfall.
Das war ein wichtiger Wendepunkt in meinem Leben. Bis dahin hatte sich mein gesamtes Sexualleben völlig auf meine Vorstellung beschränkt. Jetzt war ich sexuell aktiv geworden! Was für meinen Freund nur Experiment und Spiel war und seine Anziehung zum anderen Geschlecht nie minderte, verwirrte mich und festigte die Richtung, in die ich, ohne es zu wissen, steuerte. Während sich seine Fantasien um Mädchen drehten, hatte ich gewöhnlich einen bestimmten Jungen oder Mann vor Augen, wenn ich mich selbst befriedigte.
Nach außen hin schien ich ein normaler, glücklicher, christlicher junger Mann zu sein, der seinen Glauben und die Werte, die er äußerlich zur Schau stellen konnte, auch recht ernst nahm. In Wirklichkeit war ich aber ein kleiner Heuchler. Meine Sehnsucht nach Annahme, Anerkennung und Überlegenheit schwand nie, sondern wuchs, je mehr ich zum Mann wurde. Ebenso hatte ich mehr und mehr das Gefühl, auf moralischem Gebiet ein Versager zu sein.

Eine Warnung an alle Eltern, Sommerlagerleiter, Schullehrer usw.: Unbeaufsichtigte Übernachtungen daheim, in der Schule, im Lager und auf sonstigen Ausflügen sowie gemeinsames Duschen für Buben an Schulen und auf Zeltlagern sind Gelegenheiten, bei denen eure Kinder Dinge lernen, die sie nicht lernen sollten, und bei denen sie Versuchungen begegnen, auf die sie noch nicht vorbereitet sind!
Zeit zu heiraten – oder?
Ich war jetzt 24 Jahre alt und hatte den Eindruck, dass das Leben an mir vorüberzog, obwohl ich in meinem Theologie-Studium sehr viel erreichte. Die meisten Studenten in meinem Alter waren schon verheiratet. Innerlich rang ich immer noch mit meiner sexuellen Orientierung und überlegte mir, dass eine Heirat bestimmt alle meine romantischen und sexuellen Wünsche erfüllen würde. Zweifellos würde mein Verlangen gestillt werden.
Ich war als Einziges der sechs Kinder in meiner Familie noch nicht verheiratet. Zudem war ich älter als meine Geschwister zum Zeitpunkt ihrer Heirat. Sicherlich war ich doch weitaus reifer und besser auf eine Ehe vorbereitet, als sie es gewesen waren. Ja! Eine Ehe! Das fehlte mir in meinem Leben. Wonach sonst soll sich ein Mensch sehnen? Wie konnte ein „intelligenter“ Mensch nur so naiv und dumm sein?
Ich war 24, aber wohl nicht vernünftig genug zu erkennen, mit welchem Tier in mir ich es zu tun hatte. Auf die Ehe war ich jedenfalls nicht vorbereitet. Ich kannte sowieso keine Frau, die dafür in Frage gekommen wäre. Keine meiner Bekannten teilte meine Ziele und Wünsche für ein Leben in der Mission. Sie alle wollten ein gelbes Häuschen mit Rosengarten und weißem Lattenzaun, während ich mir Abenteuer und Erfüllung im Missionsfeld wünschte.

Im folgenden Frühsommer erhielt ich einen Brief von Leanne, einem Mädchen, mit dem ich in Korea als Studentenmissionar gearbeitet hatte. Sie war damals schon nach Hause geflogen, um den Collegeabschluss zu machen, als ich mit Kathy und ein paar Freunden noch ein weiteres Jahr nach Thailand gegangen war. Sie wollte nun diesen Sommer verreisen und überlegte, dabei auch einen Abstecher in den Ort zu machen, wo ich aufs College ging. Ob sie und ihr Bruder auf einen Besuch bei mir vorbeischauen dürften?
„Selbstverständlich“, antwortete ich ihr. Es wäre toll, sie wiederzusehen und in Erinnerungen an alte Zeiten im Fernen Osten zu schwelgen. Kurz darauf erhielt ich noch einen Brief; diesmal von dem ehemaligen Leiter der Sprachschule in Korea. Es war ein sehr netter, warmherziger und freundlicher Brief; der erste, den ich jemals von ihm erhalten hatte. Er erzählte von all den anderen Studentenlehrern, die inzwischen einander geheiratet hatten und sehr erfolgreich im Berufsleben waren. Gegen Ende sang er dann ein Loblied auf Leanne und deutete an, dass sie für jemanden wie mich die perfekte Partie wäre. Da er von ihrem geplanten Besuch wusste, ermutigte er mich zu weit mehr als nur einem Wiedersehen alter Freunde!
Mensch! Das war ein starkes Stück! Die ganze Zeit in Korea hatte ich Leanne nie durch diese Brille gesehen. Mit den anderen Mädchen war ich ab und zu ausgegangen, aber nie mit Leanne. Ja, sie war ein nettes Mädchen, hatte ein offenes Lachen, war immer fröhlich, sang gerne und war bei allen kirchlichen und geselligen Terminen dabei. Wieso hatte ich vorher nie an sie gedacht? Ein weiterer Pluspunkt war, dass wir beide in der Mission Erfahrung hatten und dafür schwärmten.
Ich begann, mich auf Leannes Besuch zu freuen. Als sie ankam, sah ich sie in einem völlig neuen Licht. Ihr schien es nicht anders zu gehen; das war offensichtlich. Nachdem sie ungefähr eine Woche mit mir und meiner Familie verbracht hatte, saßen wir eines Abends noch im Wagen, bevor wir ins Haus gingen.
„Leanne“, rang ich mich durch. „Bevor du angekommen bist, habe ich einen Brief von Jerry bekommen, und, äh, er machte mir gegenüber so eine Andeutung.“ „Oh, wirklich?“ Sie tat überrascht. „Er hat mir auch geschrieben, ein paar Monate vorher, und mich ermutigt, dich zu besuchen!“
„Nun, das hört sich für mich so an, als hätte er nebenbei noch eine Heiratsvermittlung.“
„Ja“, lachte sie. „Ich denke, das war eine abgekartete Sache.“
„Tja, was meinst du? Denkst du, das wäre eine gute Idee?“
„Du meinst, dass wir heiraten?“, sie lächelte interessiert.
„Ja“, antwortete ich vorsichtig.
„Ist das ein Heiratsantrag?“ (O Mann! Das musste ja so kommen.)
„Würdest du ‚Ja‘ sagen, wenn’s einer wäre?“ Wie man sieht, beherrschte ich dieses Spiel ebenfalls.
„Du wirst mir wohl erst einen Antrag machen müssen, um das herauszufinden.“ Es schien ihr richtig Spaß zu machen.
„Okay, würdest du? Willst du mich heiraten?“ Hatte ich das etwa wirklich gesagt?
„Ja, Jesse, ich glaube, ich will.“
Wir waren verlobt! Einfach so! Wir entschieden dann, dass sie am besten eine Woche länger bei uns bleiben sollte, damit wir uns noch besser kennenlernen und gemeinsam Hochzeitspläne schmieden konnten. Die Ferien waren in vier Wochen wieder vorbei. Sie arbeitete als Lehrerin an der Westküste und musste rechtzeitig kündigen, damit ihre Schule Ersatz für sie finden konnte. Ich musste auch wieder mit dem Studium beginnen, also beschlossen wir, in vier Wochen zu heiraten. Und wir taten es! Einige Monate lang lief alles super. Leanne war eine sehr gute Ehe- und Hausfrau. Wir lebten in einer recht kleinen Wohnung, aber sie fand für alles ein hübsches Plätzchen und richtete unser Zuhause schön und gemütlich ein. Ich arbeitete halbtags und studierte Vollzeit; Leanne fand eine Stelle als Lehrerin in der Umgebung.
Auf der Suche nach der kleinen, heilen Familie

Aber mit mir war nicht alles in Ordnung. Nach den Flitterwochen hatte ich immer weniger Interesse an körperlichem Kontakt mit ihr. Die Ärmste, sie hatte ja keine Ahnung, was los war! Aber es kam so weit, dass mich ihre Berührung und ihre Aufmerksamkeiten körperlich abstießen. Ich weiß noch, wie ich dachte, ein eigenes Kind könnte sie so beschäftigen, dass sie meine Zuwendung nicht mehr so nötig hätte. Also leistete ich so lange Überzeugungsarbeit, bis sie dem Vorschlag zustimmte. Meine Schwester Katie sei wieder schwanger, argumentierte ich, und es wäre doch so schön, wenn unsere Kinder vom Alter her dicht beieinanderliegen würden, dass sie nicht nur als Cousins, sondern auch als Freunde aufwachsen könnten.
Leanne ließ sich darauf ein, wenn auch nicht ohne Vorahnung. Drei Wochen vor unserem ersten Hochzeitstag wurde unsere kleine Stephanie geboren. Was für ein schönes Kind sie war! Dass wir ein Kind zusammen hatten, half mir wirklich. Ich fühlte mich Leanne für längere Zeit viel näher. Jetzt hatte ich wirklich das Ziel erreicht! Eine gottesfürchtige Frau, eine schöne Familie und eine vielversprechende Zukunft, denn auf akademischem Gebiet glänzte ich weiterhin mit einem sehr guten Durchschnitt.
In meinem Abschlussjahr wurde ich Praktikant in einer Gemeinde am Ort. Zur praktischen Theologie gehörte eben auch die Arbeit in einer Kirche. Das war ziemlich schwierig für mich. Nicht nur, dass es mir wegen meiner Schüchternheit nach wie vor nicht lag, vor Leuten zu stehen. Ich fühlte mich auf der Kanzel auch als Heuchler, weil mir bewusst war, welcher Kampf in mir tobte. Unweigerlich würde auch in dieser Gemeinde jemand sein, dessen Anwesenheit falsche Sehnsüchte in mir wachrufen würde. Trotzdem wurde ich von der Gemeinde freundlich aufgenommen und beendete meinen Einsatz dort mit Erfolg.
Als der Collegeabschluss immer näher kam, stand ich auf der Liste der Auszuzeichnenden. Auf diesen Tag hatte ich mich lange gefreut. Eines Nachmittags rief mich der Leiter der theologischen Fakultät in sein Büro. Ich war überrascht, dort zwei weitere, bedeutend und vornehm aussehende Herren anzutreffen.
„Jesse, ich möchte dich gerne mit Bruder Jones und Bruder Smith bekannt machen. Sie sind hier, um mit dir ein Einstellungsgespräch für eine Stelle als stellvertretender Pastor der Hauptgemeinde in der Innenstadt zu führen.“
Du meinst die große? , dachte ich und schluckte, sagte aber nichts. Ich konnte es mir nicht vorstellen, vor einer großen Versammlung zu stehen, zum einen wegen meines Lampenfiebers, zum anderen, weil ich es als Heuchelei empfand.
Während des gesamten Gesprächs saß ich da und hörte ihre Lobeshymnen auf meine akademischen Leistungen und ihre hohen Erwartungen an jemanden von meinem Kaliber. Dann dämmerte mir, dass ein Abschluss mit Auszeichnung eben Vorrechte, Chancen und Verantwortung mit sich bringt, die recht furchterregend sein können. Ich war überfordert. Ich dankte ihnen für ihr Angebot und verkündete dann zur Überraschung des Dekans, dass ich mich auf die Aufnahme an der medizinischen Hochschule vorbereiten wolle. Ohne es zu durchdenken, ja schlimmer noch, ohne darüber zu beten und stille zu werden, um mir von Gott seinen Willen zeigen zu lassen, wies ich die Berufung zum Geistlichen zurück.
Am Abrutschen
Das war wohl ein verhängnisvoller Fehler. Denn von diesem Punkt an erlebte ich einen geistlichen Niedergang, der schließlich in einer kompletten und vollständigen Bauchlandung endete.
Meine Ehe befand sich bereits in Schwierigkeiten. Außerhalb des Ehebettes verhielt ich mich meiner Frau gegenüber immer passiver und fand es zunehmend schwieriger, zu ihr liebevoll und zärtlich zu sein, weil es nicht aufrichtig gewesen wäre. Mein Leben war eine Lüge, und ich wusste es. Sie hingegen wurde immer verzweifelter, weinte viel und fragte mich, ob ich sie wirklich liebte. Um ihr nicht wehzutun, belog ich sie fortwährend. Und ich sollte ein Verkündiger des Evangeliums sein?!
Meine Schuld drückte mich nieder. Ich betete täglich: „Herr, bitte hilf mir, meine Frau zu lieben. Das ist nicht fair ihr gegenüber. Ich weiß nicht, wie ich mit der ganzen Situation umgehen soll.“ Bald darauf betete ich: „Herr, bitte hilf mir, meine Frau lieben zu wollen.“ Ich wünschte mir, ich hätte niemals geheiratet, und zermarterte mir den Kopf darüber, wie ich Leanne und der kleinen Stephanie solches Leid ersparen konnte. Wie konnte ich jemals an so einen Punkt gelangen und nun am Rande dieses Abgrunds stehen? „Herr“, betete ich. „Bitte hilf mir. Bitte lass mich nicht mein Heim und meine Familie zerstören und alle meine Lieben verletzen! Bitte hilf mir, meine Frau lieben zu wollen! Bitte schaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist!“
Monatelang flehte ich inständig zu Gott, fand aber keine Befreiung von meiner Seelenqual. Schließlich gab ich es auf. Welchen Sinn hatte das Weiterbeten? Gott schien mich nicht zu hören. Ich schloss daraus, dass ich wohl zu schlecht war. Es gab für mich keine Hoffnung. Vielleicht hatte ich den Heiligen Geist schon längst betrübt und vertrieben. Verbitterung gegen Gott schlich sich in mein Herz. Er hatte diese überwältigende Versuchung nicht von mir genommen. Was immer nun auch mit mir passieren würde, es wäre auf jeden Fall seine Schuld. Die Weichen waren gestellt. Ich war ein Homosexueller vor seinem Coming-out, der nur darauf wartete, dass sich eine günstige Gelegenheit ergab.
Endlich frei?
Meine Frau musste kurzfristig nach Westen zu ihrer kranken Mutter fliegen und nahm unsere kleine Stephanie mit. Ich war zum ersten Mal seit unserer Hochzeit allein zu Hause. Ein Gefühl der Freiheit durchflutete mich. Es war aufregend, aber auch beängstigend. Ich hatte zwar nicht vor, irgendetwas anzustellen, aber mir wurde bewusst, dass ich mich gebunden gefühlt hatte, ja irgendwie gefesselt. Ich hatte Schuldgefühle, weil ich das Alleinsein genoss, verdrängte sie aber schnell.
Jetzt, wo ich gerade alle Anforderungen für meine Zulassung zum Medizinstudium erfüllt hatte, stand ein Vorstellungsgespräch an der medizinischen Fakultät an. Als ich eines Abends in der Universitätsbibliothek war, stöberte ich auf dem Weg nach draußen noch kurz in einem Nachrichtenmagazin. Ich nahm das Time Magazine zur Hand und erschrak beim Anblick der Titelgeschichte. Sie handelte vom „Gay life“, also dem „fröhlichen“ oder schwulen Leben, in den Vereinigten Staaten. Die Schwulenszene, die auf dem Titelblatt abgebildet war, fesselte meine Aufmerksamkeit. Sie zog mich eher an, als dass sie mich abstieß, was mich verunsicherte. Ich hielt das Magazin so vorsichtig, dass niemand sehen konnte, was ich da las, blätterte zum Artikel und las mit großem Interesse die Nachrichten über die wachsende und immer öffentlicher werdende „lustig-fröhliche“ Bewegung. Obwohl ich natürlich wusste, dass es auf der Welt Leute mit den gleichen homosexuellen Neigungen gab, wie ich sie hatte, war ich noch niemandem begegnet – außer jenem Sonderling in der Kaserne in Korea. Daher hatte ich mich immer recht alleine mit meinem dunklen Geheimnis gefühlt und stets das Gefühl gehabt, dass niemand mich wirklich verstehen kann.
Dieser Artikel und die Bilder von homosexuellen Männern in verschiedenen Schwulen-Treffpunkten und Aktivitäten fesselten meine Aufmerksamkeit enorm. Ich war überrascht, wie stark diese Saite in mir zum Schwingen gebracht wurde. In dem Artikel wurden sogar einige der bekannteren Schwulenbars in verschiedenen Städten namentlich genannt. Eine davon war das Lokal „Mother’s“ in der Peachtree Avenue in Atlanta. Gibt’s das? Ich meine, liegt das wirklich so nahe vor der Haustür? , fragte ich mich. Da könnte ich ja ohne weiteres mal schauen, wie es in einer Schwulenbar so zugeht? Nee! Ich kann es mir nicht leisten, so einen Ort aufzusuchen! Oder doch? Vielleicht, wenn es niemand mitbekommt und ich ganz sichergehen kann, dass man es nie herausfindet. Dann könnte ich mich vielleicht eines Tages in so ein Lokal wagen und mir das mal ansehen. Das Adrenalin schoss mir durch die Adern: Ich war auf dem Weg in ein neues Abenteuer.
Rückblickend bin ich überrascht, wie tief ich mich in den vier Wochen, die meine Frau nicht zu Hause war, in diesen neuen Lebensstil verstrickte. Mir graute vor ihrer Rückkehr, weil ich wusste, dass ich es ihr erzählen musste. Ich wusste, dass unsere Ehe ein jähes Ende finden würde und dass es ganz allein meine Schuld war. Wie konnte ich ihr gegenübertreten? Sie war wieder schwanger. Was würden diese Neuigkeiten in ihr auslösen, und wie würde sich das auf unser ungeborenes Kind auswirken? Wie konnte ich meinem heiß geliebten kleinen Mädchen in die Augen sehen? Ich wurde von Schuldgefühlen geplagt, und das zu Recht. Ich fühlte mich wie der Abschaum der Gesellschaft, war aber absolut unfähig, die Richtung wieder zu ändern.
Meine Frau merkte aus unseren Telefonaten, dass irgendetwas nicht stimmte. Ich konnte meine Depression und Verzweiflung nicht verstecken, aber ich traute mich nicht, ihr am Telefon zu sagen, was los war. Etwa eine Woche vor ihrer Rückkehr traf ich Sonny im Club. Er war ein paar Jahre älter als ich und lebte vorübergehend in Atlanta. Wir wurden sofort Freunde, und ich entdeckte zum ersten Mal die bewegenden Gefühle, die ich die ganze Zeit für meine Frau hätte haben sollen. Aber ich empfand sie für Sonny, einen Mann. Wo ich es hätte genießen sollen, mit meiner Frau Händchen zu halten oder sie im Arm zu halten, entdeckte ich stattdessen Befriedigung durch Sonnys körperliche Zuneigung. Mein ganzes Leben stand auf dem Kopf. In dieser Umgebung fühlte ich mich normal, wohl und zugehörig. Der Wirrwarr meines Lebens löste sich auf, nur um abgelöst zu werden von den Gewissensbissen und Schuldgefühlen über das, was ich meiner Familie antat.
Das „Schicksal“ nimmt seinen Lauf
Als ich Leanne am Flughafen abholte, spürte sie sofort, dass es Ärger im Paradies gab. Ihr Gatte war ein anderer Mann, ein Fremder, geworden. Ich bemühte mich, dieselbe Person zu sein, war es aber nicht. Ich konnte nicht mehr länger eine Lüge leben. Es hatte so lange in mir gegärt, bis es knallte. Es gab kein Zurück.
Ein paar Tage lang weihte ich sie nicht in die Wahrheit ein. Aber ich konnte es nicht ewig hinausschieben. Schließlich brach ich unter den Fragen über die Ursache meiner tiefen Depression zusammen und erzählte ihr alles. Wir weinten zusammen. Es brach ihr das Herz und, weil ich die Ursache für ihren Schmerz war, mir auch. Leanne war trotz allem eine Kämpfernatur. Sie liebte mich wirklich und war nicht bereit, einfach aufzugeben. Nun, da sie die Ursache unserer Eheprobleme kannte, glaubte sie fest, wir könnten durch eine Ehetherapie Heilung finden. Über Monate gingen wir sowohl einzeln als auch gemeinsam zur Beratung. Pastoren kamen mich besuchen, und ich suchte sie auf. Aber niemand schien mir helfen zu können. Am Ende sagten professionelle Psychologen und Psychiater Leanne, sie müsse lernen, mit meiner Orientierung zu leben. Man könne mich nicht ändern.
Zwei sehr bedeutende Pastoren, die für ihre Predigten über den Sieg in Jesus bekannt waren, rieten ihr, sich von mir scheiden zu lassen. Für so einen wie mich gebe es keine Hoffnung auf Änderung. Keiner von ihnen war mir je begegnet oder hatte ein Beratungsgespräch mit mir geführt. Aber sie erteilten ihr den Rat, ihr Leben allein fortzuführen. Als meine Eltern von unserer Familientragödie erfuhren, tauchten sie auf, um mich zur Vernunft zu bringen. Bis zu diesem Punkt war ich der Stolz meines Vaters gewesen, weil ich alle seine eigenen Wunschträume verkörperte. Jetzt weinte er auf Knien vor mir. „Jesse, ich verstehe das nicht. Was habe ich getan, dass du so geworden bist? In unserer Familie hat es so etwas noch nie gegeben. Was habe ich falsch gemacht?“, fragte er ängstlich.
Zu dieser Zeit in meinem Leben hatte ich keine Ahnung. Ich konnte nicht einmal meine Fragen beantworten, geschweige denn die meines Vaters. Ich wusste nur: Ich bin, was ich bin, habe mein Leben lang dagegen angekämpft, bis ich es nicht mehr ertragen konnte. Es war zu spät. Nicht einmal Gott konnte mir helfen. Was sollten da meine Eltern oder irgendwer sonst noch ausrichten können? Meine Eltern taten mir unglaublich leid. Wieder einmal war ich die Ursache für ihre Tränen und ihren Kummer geworden.
Leanne reichte die Scheidung ein. Ich schämte mich so sehr, dass ich nicht einmal zur Verhandlung erschien. Ja, ich zog mich grundsätzlich aus allem zurück. Unser kleiner Sohn Donnie wurde an dem Tag geboren, an dem unsere Scheidung in Kraft trat. Zehn Tage später zog Leanne zurück an die Westküste. Als ich dieses kostbare kleine Bündel zum letzten Mal in meinen Armen hielt und meine kleine Stephanie zum Abschied küsste, riss es mir das Herz entzwei. Es tat mir so leid um Leanne und die Kinder. Und ich selbst fühlte mich so hilflos, so verflucht, so von Gott verlassen. Aber was sollte ich tun? Ich konnte mich selbst nicht verwandeln, genauso wenig „wie ein Mohr seine Haut oder ein Leopard seine Flecken“. Kurz nachdem meine Familie an die Westküste gezogen war, zog ich an die Ostküste. Aus Scham und Kummer, Verbitterung und Groll kehrte ich allem den Rücken: meiner Familie, meinen Freunden, meinen Träumen, meinem Wertesystem und, schlimmer noch, meinem Gott. Der Jesse, den jeder gekannt hatte, war tot. Jesse begann nun ein neues Leben in offener Sünde und gab Gott viele, viele Jahre lang die Schuld dafür.
Mein Leben in der Szene

Obwohl ich auch viele kleine Affären hatte, verfiel ich in die sehr gängige Praxis der „One-Night-Stands“, also der einmaligen Begegnung mit einem Partner, den man gerade erst kennengelernt hat und zu dem man auch gar keine Beziehung aufbauen will. Es gab Zeiten, da fühlte ich mich ziemlich billig, obwohl ich, was meine Partner betraf, sehr wählerisch war.
Eines Nachts fiel mir auf, wie ein junger Mann, der ein wenig älter war als ich, „meinen“ Nachtclub betrat. Er wirkte auffallend fehl am Platz (genau wie ich einigen Beobachtern zufolge auch). Ich stellte mich ihm vor, und es entwickelte sich ein Gespräch. Wie sich herausstellte, war er ein adventistischer Prediger und arbeitete an einem College in der Nähe. Obwohl wir beide in Schwulenbars ein- und ausgingen, merkten aufmerksame Beobachter aufgrund unseres religiösen Hintergrundes, dass wir nicht an so einen Ort gehörten.
Der junge Mann hieß Don, und wir wurden für einige Zeit gute Freunde, ja unsere Freundschaft nahm immer romantischere Züge an. Er führte mich in die religiöse Homosexuellenorganisation ein, in der er mitwirkte, und wir nahmen an einigen Veranstaltungen teil. Aber beitreten konnte ich nicht. Denn in meinen Augen vertrugen sich Homosexualität und Glauben ebenso wenig wie Öl und Wasser. Ich wusste, was die Bibel über „uns“ zu sagen hatte. Deshalb hatte ich dem Glauben ja den Rücken gekehrt, den Ruf ins Predigtamt abgelehnt. Es wäre mir sonst wie Heuchelei vorgekommen. Nach meinem Verständnis wäre es vergebliche Liebesmüh gewesen, wenn ich versucht hätte, ein geistliches Leben zu führen und gleichzeitig an meinem homosexuellen Leben festzuhalten.
Außerdem erlebte ich Don ständig in einem Konflikt, bei dem das „Gesetz in seinem Sinn“ im Streit mit dem „Gesetz in seinen Gliedern“ lag, um es einmal so zu formulieren wie der Apostel Paulus in Römer 7. Don versuchte, gleichzeitig das Beste aus beiden Welten mitzunehmen, aus dem Reich dieser Welt und aus dem Himmelreich. Die Bibel sagt aber, dass man nicht zwei Herren dienen kann; denn man wird den einen hassen und den anderen lieben. Ich hatte keine Lust auf diesen zusätzlichen Konflikt in meinem Leben. Es war zwar von Sünde durchdrungen, und ich musste die Last der Schuld tragen. Aber von der Last der Heuchelei war ich wenigstens frei. Im Gegensatz zu Don, der in der unangenehmen Lage war, diesen Spagat aushalten zu müssen, hatte ich einigermaßen Frieden mit mir selbst.
Ich führte weiter ein Leben der unverbindlichen, kleinen Romanzen. So konnte ich kommen und gehen, wann und mit wem ich wollte und ohne von jemandem Kritik dafür zu ernten. Aber dann traf ich Angelo, und diese Zeit war vorbei. Mit ihm begann ich eine monogame Langzeitbeziehung. Mit ihm unternahm ich auch den Versuch, noch einmal sesshaft zu werden und wieder etwas Stabilität und Vernunft in mein Leben zu bringen.
Seine Familie öffnete mir, genau wie Sonnys Familie vorher, Herz und Tür. Wir machten gemeinsam Urlaub, feierten gemeinsam und taten all das, was jede andere Familie auch tun würde. Für die Hochzeit von Angelos Bruder flog seine Familie mich als Fotograf nach Hawaii ein. Bei einer anderen Gelegenheit flogen wir alle gemeinsam mit seiner reizenden Omi nach Vera Cruz in Mexiko, wo sie aufgewachsen war. Ich hing sehr an dieser Familie. Als unsere Beziehung fünf Jahre später in die Brüche ging, vermisste ich seine Familie am meisten. Wir hatten uns immer gern gehabt.
In der Zeit mit Angelo betete ich schließlich zum ersten Mal: „Gott, wenn du mich aus dieser Beziehung, aus diesem Schlamasselmassel herausholst, verspreche ich dir, dass ich ein anständiger Kerl werde und mich für den Rest meines Lebens nie wieder auf homosexuelle Erfahrungen einlasse.“ Doch sobald ich frei war, setzte ich meinen Weg fort. Wie die Israeliten im Alten Testament ihren Bund mit Gott vergaßen, so hatte auch ich mein Versprechen schnell vergessen.
In all den Jahren meines Homosexuellen-Lebens fanden meine Eltern in regelmäßigen Abständen einen Anlass, mich zu besuchen. Zur Verwunderung meiner Freunde und Liebhaber waren meine christlichen Eltern willens, um nicht zu sagen: richtig erpicht darauf, mich in meiner Wohnung zu besuchen und sogar längere Zeit mit mir unter einem Dach zu bleiben. Mit den Jahren hatte sich meine Einstellung zu meinem Vater ziemlich gewandelt. Dass er und meine Mutter mich Homosexuellen und meinen Freundeskreis bedingungslos liebten, hätte ich von „Christen“ nicht erwartet. Es war ja allgemein bekannt, dass Homosexualität in ihrem Glaubensgebäude als Gräuelsünde galt.
Mama erzählte mir, dass sie in den Augen meiner Freunde eine tiefe Sehnsucht nach Annahme und Anerkennung sehen könne. Ihr Mutterinstinkt veranlasste sie, herzlich auf sie zuzugehen. Sie und Papa fühlten sich in Liebe und Anteilnahme zu ihnen hingezogen. Ihr Interesse war aufrichtig und wurde auch als solches erkannt. Daher wurden meine Eltern im Gegenzug von meinen homosexuellen Freunden und Liebhabern immer akzeptiert, geschätzt, bewundert und geliebt. Ich konnte sehen, dass meine Eltern genau wie Jesus zwar die Sünde hassten, aber uns, die Sünder, trotzdem aufrichtig liebten. Das blieb nicht ohne starke Wirkung auf mich.
Wie man den Zweig biegt
Ein altes Sprichwort lautet: „Wie man den Zweig biegt, so wächst der Baum.“ Ich bin mir nicht sicher, wer das gesagt hat. Dennoch bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass es stimmt. Bis dahin waren meine Jahre in der Homosexuellenwelt nicht nur von Selbsterhebung geprägt gewesen, von Selbstverwirklichung und Selbstbestätigung, sondern sogar von Selbstgerechtigkeit und Vorwürfen gegen Gott. Konnte es aber sein, dass ich schon als Zweig gebogen worden war? War ich vielleicht ein Produkt meiner Umstände und meiner Umwelt? Und wenn ja, änderte das wohl auch nichts. So oder so blieb ich homosexuell.
Mein eigenes Leben glich einer Abwärtsspirale in die Selbstzerstörung. Als Christ erzogen, hatte man mir deutlich vermittelt, welche Folgen Rauchen und Trinken haben sowie Drogenmissbrauch, allgemeine Ausschweifung und unerlaubte sexuelle Aktivitäten. Meine eigene Zukunft erschien mir plötzlich recht düster. „Aber was kann ich an meiner Verlorenheit ändern?“, quälte ich mich. „Ich kann nichts dafür. Ich bin so, wie ich bin. Ich wurde so geboren. Alles ist Gottes Schuld“, versuchte ich, mich zu trösten.
Doch mir wurde schon bald klar: Diese Schuldzuweisung war nur mein schwacher Versuch, mich aus der Verantwortung zu stehlen. Also fing ich tatsächlich an, mich zu analysieren, meine Kindheitserfahrungen zu durchleuchten, um meine Homosexualität zu begreifen; anfangs noch vorsichtig, weil es zu sehr wehtat.
„Könnte es wirklich meine eigene Schuld sein?“, fragte ich mich. „Könnte es wirklich sein, dass ich infolge meiner eigenen Entscheidungen homosexuell wurde?“ „Nein, unmöglich!“ argumentierte ich. „Ich habe es mir nicht ausgesucht. Ich hatte mich immer für das Richtige entschieden, bis ich schließlich mein Inneres nicht mehr verleugnen konnte. Ich wollte immer gut sein, akzeptiert und geschätzt werden, Erfolg haben. Daher hatte ich mich nach bestem Wissen und Gewissen dafür entschieden, ein Mensch zu sein, der akzeptiert, geschätzt und bewundert wird.“

„Die Sachlage ist eindeutig!“, fuhr ich fort. „Ich hatte mir christliche Schulen ausgesucht, die Highschool und dann das College! Ich hatte mich als junger Mensch entschieden, Missionar zu werden! Ich hatte die Entscheidung fürs Theologiestudium getroffen und wollte meinen Abschluss mit Auszeichnung machen! Ich hatte mir eine christliche Frau ausgesucht. Wir hatten uns für christliche Kinder entschieden und dafür, ein christliches Zuhause zu gründen. Wie konnte jemand, der die ganze Zeit nur die richtige Wahl getroffen, der den Weg zum Glück gewählt und sich an Gottes Richtlinien für seine auserwählten Kinder gehalten hatte, sich so schnell so weit von Gott entfernen?“, fragte ich mich.
Wenn ich ehrlich war, musste ich erkennen, dass ich vor fünfzehn Jahren von der Versuchung überwältigt worden war, den bösen Neigungen nachzugeben, mit denen ich mein ganzes Leben lang zu kämpfen gehabt hatte. Ich hatte zwar unermüdlich zu Gott gebetet: „Schaffe in mir ein reines Herz und erneuere in mir deinen guten Geist!“ Ich hatte ihn angefleht, mich vor dem Fall in ein Sündenleben zu bewahren, aus dem es in meinen Augen kein Zurück mehr gab. Aber ich hatte nie feststellen können, dass Gott meine Gebete erhörte.
Am Ende hörte ich einfach auf zu beten, gab auf, fiel in Sünde, verlor meine Familie, verließ die Gemeinde und gab in den folgenden Jahren verbittert Gott die Schuld für meinen Absturz. Er war mir nicht zur Rettung geeilt. Nie zuvor hatte ich darüber nachgedacht, dass ich erst in dieses Sündenleben eingetaucht war, nachdem ich aufgehört hatte, um Rettung zu beten. Ich hatte aufgegeben, weil ich nicht von der Versuchung befreit worden war. Konnte es sein, dass es am Ende gar nicht Gottes Schuld gewesen war? War es möglich, dass ich wirklich selbst schuld war, weil ich nicht weiter gebetet und widerstanden hatte?
Eine ganze Zeit lang setzte ich meine Gewissensprüfung und Selbstanalyse fort. Ich trug eine Schicht meines Lebens nach der anderen ab, um mich eingehend zu durchleuchten. Ein schmerzhafter Prozess. Dabei stellte ich mir die unvermeidliche Frage, ob meine erste sexuelle Erfahrung in der Kindheit (die ja homosexueller Natur war) irgendeinen Einfluss auf die Richtung gehabt haben könnte, die mein Leben genommen hatte. Ich war damals vier Jahre alt gewesen, als ich mit sexuellem Verhalten bekannt gemacht worden war. Das war tatsächlich von entscheidender Bedeutung für meine Kindheitsentwicklung und mein Heranwachsen gewesen. Da mir jegliche Vergleichsmöglichkeit fehlte, hatte sich die Erinnerung an diesen Vorfall mit allen Details tief in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich fühlte mich selbst zu schmutzig und zu schuldig, um mit meinen Eltern oder sonst irgendjemandem darüber zu sprechen. Deshalb musste ich alles völlig allein verarbeiten. Ich wage zu behaupten, dass ein vierjähriges Kind damit geistig und emotional überfordert ist. Es ließ mich glauben, ich sei ein unnormaler Sonderling.
Vor diesem ersten sexuellen Erlebnis kann ich mich nicht an ein Problem mit dem Bettnässen erinnern. Meine Eltern haben mir bestätigt, dass alle ihre Kinder mit drei sauber waren, ich bildete da keine Ausnahme. Deshalb waren sie über meinen plötzlichen Rückfall mit vier völlig perplex. Als ich meine Vergangenheit immer tiefer durchleuchtete, dämmerte es mir langsam: Ich hatte dieses tiefe, dunkle Geheimnis für mich behalten und das sexuelle Trauma in meiner Kindheit unterdrückt. Dadurch war wohl eine emotionale Störung entstanden, die sich körperlich durch mangelnde Kontrolle der Blasenfunktion äußerte. Natürlich sah ich als Kind keinen Zusammenhang zwischen diesen Dingen, ja nicht mal als Teenager oder junger Erwachsener. „Wie man den Zweig biegt, so wächst der Baum …“
Nicht die Gene entscheiden
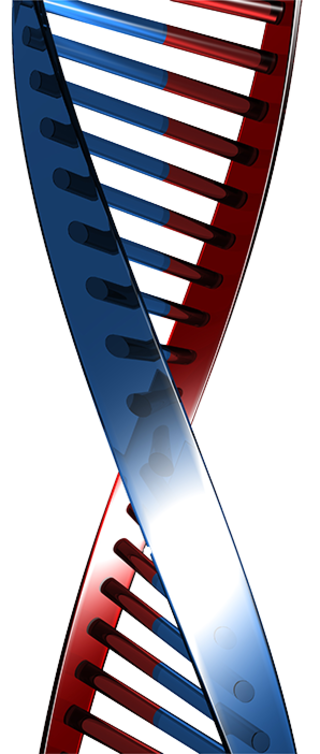
An diesem Punkt fallen mir die zahlreichen Argumente ein, die meine Brüder und Schwestern in der Homosexuellengemeinde anführen, um zu erklären, dass die sexuelle Orientierung unveränderlich sei. Meine eigene Selbstanalyse hat mich jedoch überzeugt, dass die Umstände meine „Neigung“ bestimmt haben. Mehr als ein Drittel aller Homosexuellen glaubt, dass sie so geboren wurden – das sind übrigens 400 % mehr als vor fünfzig Jahren. Folglich glauben sie, dass Homosexuelle unfähig sind, sich zu ändern oder ändern zu lassen. Ich respektiere ihre Überzeugung, denn jahrelang glaubte ich dasselbe. Ich bin sogar der Überzeugung, dass dies den Tatsachen entspricht, solange man daran glaubt. Denn die Wahrnehmung ist im Kopf des Wahrnehmenden Realität. Trotz allem gibt es viele wissenschaftliche Beweise, die die Theorie untermauern, dass gleichgeschlechtliche Orientierung ein erlerntes Verhalten ist.
Als Homosexueller habe ich solche „lächerlichen“ wissenschaftlichen Behauptungen natürlich für Unfug gehalten, weil sie offensichtlich von voreingenommenen, heterosexuellen Forschern mit homophober Ausrichtung stammten, die mein Denken und Fühlen nicht verstehen konnten – so dachte ich damals.
Aber ob jemand homosexuell geboren worden ist, sich freiwillig entschieden hat oder durch sein Umfeld so geprägt worden ist, ist gar nicht die eigentliche Frage. Die Frage ist eher: Wie kann dem Homosexuellen sein wahres Bedürfnis bewusst gemacht werden, falls es solch eines gibt? Wie kann dieses Bedürfnis gestillt werden? Dabei spielt es keine Rolle, wie und warum er so geworden ist, wie er ist. Akzeptieren wir Homosexualität in uns selbst oder in anderen einfach als alternativen Lebensstil? Oder sehen wir das Bedürfnis nach einer neuen Ausrichtung und auch einen Weg, dieses Ziel zu erreichen? Ist das Thema Homosexualität eine Heilsfrage oder gar kein Thema? Ist es eine Frage mit ewigen Auswirkungen? Ist Jesus erschienen, um den Homosexuellen in seiner Homosexualität oder von seiner Homosexualität zu retten (Mt 1,21)?
Licht am Ende des Tunnels
Nachdem ich mit meiner Selbstanalyse weiter vorangekommen war, machte sich mit der Zeit ein bohrendes Verlangen nach einer geistlichen Komponente in meinem Leben breit. Dieses Verlangen weckte wiederum in mir das Bedürfnis, einigen Fragen auf den Grund zu gehen. Anfangs war es nur eine kleine Sehnsucht, doch allmählich wurde sie immer stärker. Irgendwo fand ich eine alte Bibel und versuchte, sie zu lesen. Aber ich fand sie zu langweilig. Ich konnte keinen Geschmack an geistlicher Kost finden, schon gar nicht an hochkonzentrierter Bibelnahrung.
Bald schon kramte ich einige der Mitbringsel meiner Eltern hervor und begann sie durchzublättern. Ich erinnere mich, wie ich mich eines Tages entschloss, mir eines ihrer Bücher näher anzusehen. Doch zuerst mixte ich mir einen schönen, großen, eiskalten Cocktail. Dann setzte ich mich mit dem Cocktail in der einen Hand hin, zündete mir mit der anderen eine Zigarette an und begann das Büchlein mit dem Titel Wie findet man inneren Frieden? zu lesen. Plötzlich wurde mir klar, wie grotesk das alles auf Gott wirken musste. Daher sagte ich so nebenbei: „Gott, du weißt bestimmt, dass diese Zigarette und dieser Cocktail im Augenblick in meinem Leben die kleinsten Probleme sind. Mal sehen, welche Antworten du für meine größeren hast. Wenn ich etwas Brauchbares finde, können wir uns später auch über diese kleinen Laster unterhalten.“
Also las ich weiter. Das Buch war wunderbar. Auf der allerersten Seite las ich: „Natur und Offenbarung zeugen gleichermaßen von der Liebe Gottes … Obwohl die Welt gefallen ist, besteht sie doch nicht gänzlich aus Leid und Elend. In der Natur selbst finden wir Botschaften der Hoffnung und des Trostes. Es wachsen Blumen zwischen den Disteln, und die Dornen sind mit Rosen bedeckt.“
Mensch! Was für eine Lebensanschauung diese Autorin hatte! Genau das brauchte ich: Hoffnungs- und Trostbotschaften, denn ich führte wirklich das Leben eines Verzweifelten. Ich rauchte immer noch und nippte an meinem Cocktail, als ich bei Kapitel fünf anlangte. Hier las ich: „Gott verlangt von uns nicht, etwas aufzugeben, das zu unserem Besten wäre. Bei allem, was er tut, hat er das Wohl seiner Kinder im Auge. Würden doch alle, die sich nicht für Jesus entschieden haben, erkennen, dass er ihnen etwas weitaus Besseres anbietet, als sie es für sich selbst suchen. Echte Freude lässt sich nicht auf dem Weg finden, den er verboten hat. Denn nur er weiß, was das Beste ist. Er plant zum Wohl seiner Geschöpfe. Der Weg der Übertretung dagegen ist der Weg des Elends und der Zerstörung …“
„… den er verboten hat. Denn nur er weiß, was das Beste ist“, wiederholte ich leise. Ob mein homosexueller, scheinbar auswegloser Lebensstil auch zu diesem verbotenen Weg gehörte?
Ich beugte mich hinüber und drückte meine Zigarette aus. Mir wurde klar, dass es keine Entschuldigung für meine „Schwäche“ gab. Wow! Ich glaube, ich habe Gott bisher völlig missverstanden! Die ganzen Jahre habe ich ja ihn für meinen Schmerz und das Leid und Elend verantwortlich gemacht. Dabei habe ich mir das durch meinen beharrlichen Widerstand wohl selbst zuzuschreiben. Ich wollte mich nicht auf seinen Plan einlassen, obwohl doch gerade dieser Plan nur meinen Frieden und mein Glück zum Ziel hatte. Jetzt machte es plötzlich Sinn. Bestimmt weiß ein „Vater“ am besten, was das Richtige für die Kinder ist, die er selbst geschaffen hat.
An diesem Punkt machte es bei mir Klick. Ich konnte einen winzigen Lichtpunkt am Ende meines Tunnels sehen. Ich musste weiterforschen und allen meinen Fragen auf den Grund gehen. Obwohl mir das Bibellesen schwerfiel, blieb ich oft lange wach, manchmal bis 2:00 Uhr morgens, und las dieses Buch und noch ein weiteres, das die Geschichte der großen Kontroverse zwischen Jesus und Satan erzählt, die im Himmel begonnen hat und schließlich hier auf Erden enden würde. Es dauerte gar nicht lange, bis ich auch die Bibel mit Vergnügen las, manchmal stundenlang.
Gemeindeerlebnisse
Eines Tages entschloss ich mich, eine Adventgemeinde in der Nähe von Los Angeles zu besuchen. Einer meiner Firmenkunden hatte mich eingeladen, und ich hoffte auf eine wenigstens einigermaßen interessante Abwechslung. Zu meinem Unbehagen stellte sich heraus, dass die Predigt an diesem Tag ausgerechnet von der Zerstörung Sodoms und Gomorras handelte! Ich fühlte mich zunehmend unwohl, vor allem, weil ich persönlich sechs weitere Homosexuelle kannte, die mit mir in diesem Gottesdienst saßen. Fünf von ihnen, zu denen auch mein Kunde gehörte, waren aktive Glieder dieser Gemeinde.
Also fragte ich mich, in welche Richtung die Predigt des Pastors wohl gehen würde. Nicht ein einziges Mal sprach er über Homosexualität, weder beim Nacherzählen der Begebenheit, noch in der Kernaussage seiner Predigt. Nicht ein einziges Mal wurde Homosexualität als eine der Sünden Sodoms bezeichnet, noch wurde sie überhaupt als Sünde erwähnt. Vielmehr kam er zu dem Schluss, dass die Sünde Sodoms und Gomorras die Ungastlichkeit war!
Wie bitte?! Ich war völlig sprachlos. Ungastlichkeit?! Ich bin homosexuell und kann über Homosexuelle etwas ganz anderes erzählen!
Als der Gottesdienst zu Ende war, dachte ich: In dieser Gemeinde könnte ich mich zwar mit meiner Homosexualität wohl fühlen, der Wahrheit komme ich hier aber nicht näher. Dabei hätte ich wirklich gerne die Wahrheit kennen gelernt, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Bis dahin hatte ich ungefähr fünfzehn Jahre lang in der Szene gelebt.
Eines Tages stellte einer meiner Geschäftskollegen in einem Gespräch mit mir fest, dass ich auch einmal Glied der Adventgemeinde gewesen war wie er. Daraufhin lud er mich ein, ihn ab und zu zum Gottesdienst zu begleiten.
Ein paar Wochen später tat ich das dann auch, aber aus bloßer Neugier. Als Geschäftsmann hatte ich etliche schöne Anzüge im Schrank und wusste, dass der beste davon gerade gut genug für die Kirche war. Aber ich entschied mich, keinen davon zu tragen. Stattdessen suchte ich absichtlich ein paar Sachen aus, die für einen Gottesdienst wirklich nicht passten; Kleidung, die besagte: „Ich gehöre nicht dazu. Leute, ich bin keiner von euch.“ Eigentlich kleidete ich mich so, als würde ich zur „Happy Hour“ in eine Schwulenbar gehen. Vielleicht wollte ich unbewusst Aufmerksamkeit erregen; vielleicht war es ein versteckter Hilfeschrei und ich sehnte mich nach jemandem, der erkannte, dass ich aus der Welt war und geistliche Hilfe brauchte.
Als ich die Kapelle mit ihren ungefähr 5000 Besuchern betrat, dachte ich bei mir: Meine Güte! Hier sind ja lauter Gäste! Nachdem ich mich in der Versammlung umgesehen hatte, stellte ich zu meiner Überraschung fest, dass ich in der Menge keinesfalls als Gast auffiel. Die Gemeinde war extrem tolerant. Nichts an der Erscheinung dieser Leute ließ mich erkennen, dass sie dem Reich Gottes angehörten statt „dieser Welt“; die äußere Erscheinung dieser Menschen, die sich selbst Christen nannten, stieß mich ab, obwohl sie mir bei säkularen Leuten gar nichts ausgemacht hätte.
Während des gesamten Gottesdienstes stand ich unter Schock. Die Band mit ihren Sängern auf der Bühne machte Rock ’n’ Roll-Musik. Fünfzehn Jahre lang hatte ich selbst zu weltlichen Tänzen aufgefordert. Diese Musik hier erreichte nicht mein Herz, sondern ließ mein Tanzbein zucken. Sie richtete meine Gedanken nicht zum Himmel, sondern weckte Assoziationen mit den Nacht- und Tanzclubs, die ich in den letzten Jahren frequentiert hatte. Eine Kirche sollte meiner Meinung nach ein Zufluchtsort vor dem Krach und Lärm der Welt sein, statt das zu verstärken, wovor man eigentlich fliehen sollte.
Ich beobachtete, wie die Stimmung der Versammlung durch die Beleuchtung und die Musik gesteuert wurde. Viele reagierten mit schamloser Ungehemmtheit. Die Szene glich dem Geschehen auf den Rockkonzerten und in den Theatern, die ich in den letzten fünfzehn Jahren regelmäßig besucht hatte. Die emotionale Manipulation in diesem Gottesdienst störte mich enorm. Etwas später wurde ein Anspiel auf der Bühne aufgeführt. Das ist kein Gottesdienst, dachte ich bei mir. Das ist Theater! Ich erinnere mich, dass mir während des Gottesdienstes die Tränen kamen, als ich leise murmelte: „Gott, was haben sie mit deiner Gemeinde gemacht?“
„Was hast du in den letzten fünfzehn Jahren getan, um das zu verhindern?“, antwortete er prompt in meinen Gedanken. Anstatt die Gemeinde zu verurteilen, spürte ich Scham und Gewissensbisse. Ja, ich war zum Prediger des Evangeliums ausgebildet worden. Hatte ich auch nur irgendetwas in den letzten fünfzehn Jahren für Gottes Ehre getan? Nein, gar nichts! Ich erinnere mich noch, wie niedergeschlagen ich war, als ich vom Parkplatz fuhr. Eigentlich war es, als würde man ein Restaurant verlassen, nachdem man nur den Salat gegessen hat (ohne Dressing). Ich fühlte mich weder satt und zufrieden noch genährt.
In einer anderen Gemeinde, die ich besuchte, sprach ein Gastredner, der ein sehr prominenter Theologe einer bekannten Bildungsanstalt war. Ich war sehr beeindruckt von seinem Vortrag, bis er ungefähr in der Mitte seiner Rede eine Aussage machte, die mich bestürzte. „Wir werden so lange sündigen, bis Jesus wiederkommt, um uns nach Hause zu holen …“
Wie bitte?, dachte ich bei mir. Habe ich diesen Mann richtig verstanden? Ich traute meinen Ohren nicht. Für jemanden wie mich, der die Freuden des Sündenlebens fünfzehn Jahre lang in vollen Zügen genossen hatte und jemand, der sich nun verzweifelt danach sehnte, frei von diesen Fesseln, diesem Lebensstil zu werden, war der Gedanke, dass wir bis zur Wiederkunft Jesu sündigen würden, ein vernichtender Schlag. Wo blieb da die Hoffnung? Ich wollte nicht in meinem Sündenleben gerettet werden. Ich brauchte und suchte verzweifelt Rettung von der Sünde, von der Homosexualität! Warten bis Jesus wiederkommt? Das dauerte mir zu lange. Ich befand mich in einer selbstzerstörerischen Abwärtsspirale und brauchte dringend einen Retter, der mich vor mir selbst retten konnte, und zwar noch in diesem Leben.
Flucht aus Sodom
Ich kam mir ein wenig wie Lot vor, der aus Sodom herausgeschleppt wurde, als ich mit der Unterstützung meiner Eltern aus Kalifornien flüchtete, oder wie Mose, der Ägypten verließ, um die nächsten vierzig Jahre in der Wüste zu verbringen. Auch ich entschied mich nämlich, aufs Land zu ziehen und meine eigene Wüstenerfahrung zu machen. Aber schon nach drei Tagen mit meiner Familie auf dem Land hielt ich es nicht mehr aus: Ich musste unter Leute.
Ich musste Autos und Verkehr sehen. Hatte ich Entzugserscheinungen vom Verkehrschaos in Los Angeles? Ich sprang ins Auto und fuhr eineinhalb Stunden zur nächstbesten Stadt. Mir war ganz egal, wie groß sie war; Hauptsache Leute und Trubel. In einem schwachen Moment hielt ich sogar nach einem Nachtclub Ausschau. Aber ich stellte fest, dass ich mich in einem sogenannten „Dry County“ befand, also einem Landkreis, in dem der Verkauf, Ausschank und Transport von Alkohol stark eingeschränkt oder verboten war! Obwohl ich mein Leben in der Szene hinter mir gelassen hatte, traf das nicht auf „Kleinigkeiten“ wie Zigaretten und ein paar andere schädliche Substanzen zu. Aber der Herr sollte mich bald auch davon befreien.
Nachdem ich ins Haus meiner Eltern zurückgekehrt war, richtete ich mir mein Leben „in der Wüste“ ein. Eigentlich war es erstaunlich, wie schnell ich mich daran gewöhnte. Ich konnte nicht genug bekommen von selbst gebackenem Brot, eingekochtem Apfelmus und eingefrorenen Heidelbeeren. Die täglichen Spaziergänge an der frischen Landluft waren ebenso belebend wie die Arbeit mit meinem Vater im Garten. Ja, dachte ich, ich könnte mich tatsächlich an dieses Leben auf dem Land gewöhnen.
Als ich Jesus als Erlöser angenommen hatte, spürte ich sofort das Anliegen, in irgendeiner Form für ihn tätig zu werden. Die Geschichte von Jona ging mir nicht aus dem Kopf. Er verbrachte drei Tage im Bauch des Wals, nachdem er sich geweigert hatte, Gottes Ruf nach Ninive zu folgen. Ich muss eine noch härtere Nuss gewesen sein: Um zu mir durchzudringen, hatte der Herr sechzehn Jahre gebraucht. Jetzt, wo ich ihn und seinen Erlösungsplan hatte annehmen dürfen, machte ich mir daher viele Gedanken über die Verantwortung, die diese Entscheidung mit sich brachte. Ja, ich war ein Langzeit-Jona gewesen. Was hatte der Herr nun für mich zu tun? Immer wieder stellte ich mir diese Frage. Ich betete, dass der Herr mir eine zweite Chance geben würde, für ihn als Prediger zu arbeiten.
Ein neuer Anfang
Meine Taufe war etwas ganz Besonderes und Heiliges für mich. Ich war mir der Symbolik dieser Handlung vollkommen bewusst: Ich hatte im Vertrauen beschlossen, mit Jesus dem alten Sündenleben zu sterben, mit Jesus den alten Sündenmenschen im Wassergrab zu versenken, mit Jesus zu neuem Leben aufzuerstehen. Er würde mir sowohl das Wollen als auch das Vollbringen dazu schenken nach seinem Wohlgefallen. Er hatte mir sein Wort darauf gegeben, dass er das gute Werk, das er in mir angefangen hatte, auch vollenden würde. Ich brauchte nicht daran zu zweifeln, dass er mich davor bewahren kann, wieder in mein altes, würdeloses Sündenleben zu fallen. Er hat versprochen, dass er „die Macht hat, mich vor dem Fallen zu bewahren, sodass ich untadelig und voller Freude und Jubel vor seinen Thron treten“ kann. Dieser Teil seines Werkes und seines Dienstes macht ihm besonders große Freude. Als ich meine Geschichte in Form eines Rundbriefes für meine Bekannten aufgeschrieben hatte, war ich auf die Einzelheiten meines Sündenlebens nicht eingegangen. Ich hatte nur geschrieben: „Die Details meines Sündenlebens sind nicht Thema dieses Briefes. Ich möchte Satan und seinen Glücksillusionen nicht unnötig Platz einräumen. Mit diesem Brief möchte ich vielmehr Gott die Ehre geben.“
Es war jedoch etwas anderes, als man mich ausdrücklich darum bat, mein Zeugnis zu konkretisieren und den sündigen Lebensstil meiner Vergangenheit beim Namen zu nennen. Ein besorgtes Paar wünschte sich das sehr für ihren homosexuellen Sohn. Ich schrieb es also nieder und sandte es der Familie in Not zu. Meine Geschichte zog zwar bald Kreise. Aber ich konnte darauf vertrauen, dass dies zu Gottes Plan gehörte und zu seinem Ruhm und seiner Ehre beitrug.
Auch du kannst heil werden!

Die Heilige Schrift sagt, dass der ganze Himmel über einen Sünder jubelt, der umkehrt. Je tiefer das Leid und der Schmerz, desto größer auch die Freude, die uns damit in Aussicht gestellt wird. Wer tiefes, tiefes Leid erlebt hat, darf daher an der Hoffnung auf überschwängliche Freude und unglaubliches Glück festhalten. Und wem viel vergeben wird, der liebt auch viel.
Nachdem ich durch Gottes Gnade gerade mein homosexuelles Leben hinter mir gelassen hatte, sagte ein schwuler Freund von mir, der selbst einige Jahre Pastor gewesen war: „Jesse, ich werde ein Auge auf dich haben. Wenn du zwei Jahre durchhältst, dann glaube ich daran, dass ich vielleicht auch dazu fähig bin.“ Ich bete zu Gott, dass mein Zeugnis irgendwie in die Hände dieses lieben Freundes gelangt. Denn mittlerweile führe ich nicht nur seit zwei, sondern schon seit über zwanzig Jahren ein Siegerleben.
Mein Freund, auch du kannst heil werden!
Ron Woolsey, „Homosexualität – (k)ein Schicksal “, Standpunkte (Ausg. 24, 2014), S. 66-82
